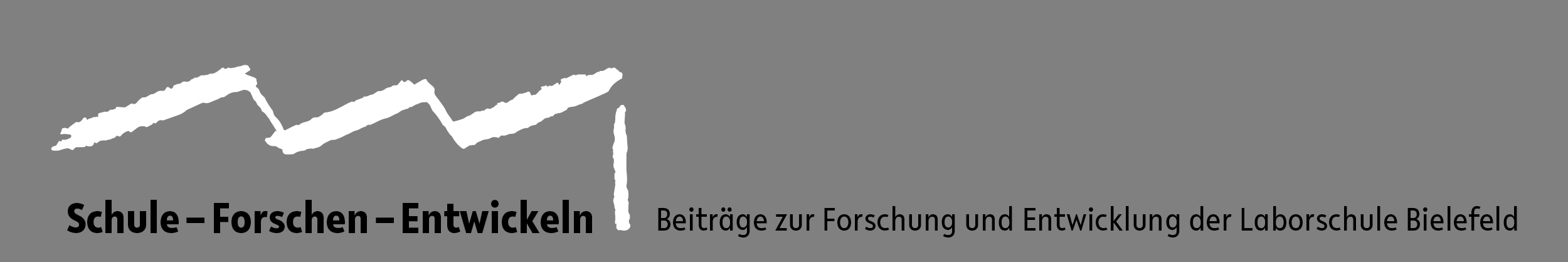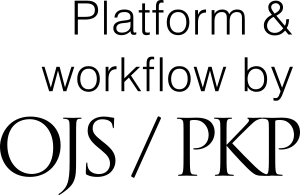Beitragseinreichung
Richtlinien für Autor/innen
Wichtige Hinweise und Formatierungsrichtlinien für Beiträge für das Online-Journal "Schule - Forschen - Entwickeln" der Wissenschaftlichen Einrichtung Laborschule
(Stand: 08.05.2025)
Um den Aufwand für die Redaktion in vertretbaren Grenzen zu halten, bitten wir um Beachtung der folgenden Manuskriptrichtlinien. Die Redaktion behält sich vor, Texte, die nicht den formalen Anforderungen entsprechen, zur Bearbeitung zurückzusenden.
Dateiformat und Schrift
Bitte reichen Sie Ihren Beitrag ausschließlich als Word-Datei (.docx) ein. Im gesamten Text wird ausnahmslos die Schrift Arial verwendet.
Rechtschreibung und Fremdwörter
Es gilt die Rechtschreibung der letzten Ausgabe des Dudens. Sind mehrere Schreibweisen erlaubt, nehmen Sie bitte die gelb unterlegte Version.
Fremdwörter, die nicht im Duden stehen, werden in doppelte Anführungsstriche gesetzt und in der Schreibweise der entsprechenden Fremdsprache geschrieben (z.B. „knowledge“).
Geschlechtergerechte Sprache
Bitte achten Sie auf eine geschlechtergerechte Sprache. Verzichten Sie dabei auf das Binnen-I und auf Schrägstriche, und verwenden Sie stattdessen möglichst geschlechtsneutrale Begriffe (wie Lehrkraft, Kind) oder aber ein Binnen-Sternchen (Schüler*in, Schüler*innen, Verfasser*innen etc.).
Wenn dies aus grammatischen Gründen nicht möglich ist, bspw. wegen der Notwendigkeit eines Genitivs, werden beide Formen ausgeschrieben und durch „bzw.“ verbunden (z.B. „des Schülers bzw. der Schülerin“).
Dokumentvorlage / Formatvorlagen
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Text zu formatieren. Unabhängig davon, welchen Weg Sie wählen, halten Sie sich bitte zwingend an den Satzspiegel von 13 x 24 cm. Das betrifft auch Tabellen und Abbildungen!
- Wenn Sie Ihren Beitrag lieber in ein Dokument hineinschreiben möchten, in dem die Formatierungen genau beschrieben und als Beispiele vorgegeben sind, können Sie direkt in unserer „Formatvorlage“ arbeiten.
- Wenn Sie Ihren Beitrag selbst (um-)formatieren wollen, richten Sie sich bitte nach folgenden Angaben:
Satzspiegel
13 x 24 cm
Fließtext (Formatvorlage: Fließtext_SFE)
Arial 11, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 0 pt., Abstand nach: 0 pt., keine Silbentrennung. Die Formatvorlage Fließtext wird im gesamten Beitrag durchgehend verwendet.
Überschrift erster Ordnung (1, 2, 3 etc.) (Formatvorlage: Überschrift 1_SFE)
Arial 14, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 16 pt., Abstand nach: 10 pt., 0,6 cm hängend.
Überschrift zweiter Ordnung (1.1, 1.2, 1.3 etc.) (Formatvorlage: Überschrift 2_SFE)
Arial 12, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 12 pt., Abstand nach: 6 pt., 0,8 cm hängend.
Überschrift dritter Ordnung (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 etc.) (Formatvorlage: Überschrift 3_SFE)
Arial 11, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 10 pt., Abstand nach: 6 pt., 1 cm hängend.
Langes Zitat (Formatvorlage: Langes Zitat_SFE)
Arial 11, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 6 pt., Abstand nach: 6 pt., eingerückt: 0,75 cm.
Lange Interviewpassage (Formatvorlage: Langes Zitat_SFE)
wie Langes Zitat, aber kursiv.
Literaturverzeichnis (Formatvorlage: Literatur_SFE)
Arial 11, Zeilenabstand: mehrfach (1,2 Zeilen), linksbündig, Abstand vor: 0 pt., Abstand nach: 0 pt., hängend 0,8 cm.
Alle anderen besonderen Formate wie Abbildungsunterschrift und Tabellenüberschrift formatieren Sie bitte einfach wie Fließtext_SFE.
Zusammenfassung und Schlüsselwörter
Für alle Beiträge sind eine Zusammenfassung und in der Regel drei bis fünf (maximal sieben) aussagekräftige Schlüsselwörter erforderlich. Die Zusammenfassung soll eine Länge von maximal 250 Wörtern nicht überschreiten. Fügen Sie Zusammenfassung und Schlüsselwörter bitte in der Vorlage ein.
Überschriften
Innerhalb des Beitrags werden Überschriften erster, zweiter und evtl. dritter Ordnung mit den Vorlagen „Überschrift 1_SFE“ (ohne Punkt!), „Überschrift 2_SFE“ und „Überschrift 3_SFE“ formatiert. Bitte verwenden Sie zur Gliederung die Dezimalklassifikation bis maximal drei Stufen und achten Sie auf eine klare Hierarchisierung. Überschriften von Tabellen sowie die betreffenden Quellenangaben und Abbildungsbezeichnungen und -quellen erfolgen im Format „Abb_Tab_SFE“.
Fortlaufender Text
Der fortlaufende Text, wird mit „Fließtext_SFE“ formatiert. Zitate von mehr als drei Zeilen Länge werden als gesonderte Absätze ebenfalls mit „Langes Zitat_SFE“ formatiert. Aufzählungen und Nummerierungen basieren auf dem Format „Fließtext ohne“ und werden mit dem Punkt (Vorlage „Aufzählung_SFE“) bzw. der (1) Ziffer (Vorlage „Nummerierung_SFE“) in runden Klammern formatiert.
Anmerkungen / Fußnoten
Anmerkungen werden als Fußnoten fortlaufend nummeriert und auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Sie sollen nur für inhaltliche Erläuterungen und Kommentierungen genutzt werden, nicht für Literaturhinweise oder bibliografische Angaben. Sie werden mit der Vorlage „Fußnotentext_SFE“ formatiert. Bitte verwenden Sie die automatische Fußnotenfunktion von Word.
Tabellen, Grafiken, Abbildungen
Bitte achten Sie unbedingt auf Skalierbarkeit. Abbildungen und Tabellen können nur aufgenommen werden, wenn sie die maximale Satzspiegelgröße (13 x 24 cm) nicht überschreiten und möglichst hochkant formatiert sind!
Abbildungen und Tabellen sollen in den Haupttext eingebunden werden, damit die gewünschte Platzierung klar erkennbar ist. Außerdem müssen sie zusätzlich zum Haupttext in gesonderten Dateien eingereicht werden, Abbildungen bitte als Original-Bild- oder Excel-Datei und Tabellen als Word-Datei.
Bitte denken Sie daran, bei fremden und eigenen Schaubildern gegebenenfalls die Abdruckrechte einzuholen und die Quelle (in runden Klammern hinter dem Titel) genau anzugeben. Bei eigens erstellten Abbildungen oder Tabellen genügt die Angabe „eigene Berechnung“ bzw. „eigene Darstellung“.
Bitte nehmen Sie auf Tabellen und Abbildungen möglichst im fortlaufenden Text konkret Bezug (z.B. „vgl. Abb. 3“) und stellen Sie ihre wichtigsten Inhalte und Kernaussagen so dar, dass sie für alle Lesenden gut nachvollziehbar sind.
Abbildungen, Grafiken und ggf. Tabellen müssen mit Alternativtexten versehen werden, damit sie für Screenreader lesbar sind. Diese Alternativtexte werden nicht mit abgedruckt und veröffentlicht, sondern für Screenreading-Programme hinterlegt und dann ggf. deren Nutzer*innen vorgelesen.
Die Alternativtexte setzen Sie bitte unterhalb der Abbildungsunterschrift bzw. unter die Tabelle mit dem Titel „Alternativtext Abbildung XY“ bzw. „Alternativtext Tabelle XY“. Die Alternativtexte sollen in wenigen Sätzen knapp beschreiben, was in der Abbildung bzw. der Tabelle zu sehen ist und was deren Kernaussage ist.
Wenn eine Abbildung oder Tabelle und ihre Kernaussage bereits im Fließtext hinreichend nachvollziehbar erläutert werden, genügt bspw. der Hinweis: „Verbildlichung der Zahlen, die im Text erläutert wurden“.
Bei sehr komplexen Grafiken kann es sinnvoll sein, nur Alternativtexte zu nutzen und die Inhalte der Abbildung nicht für Screenreader zugänglich zu machen. In diesem Fall müssen die Alternativtexte alle Elemente der Abbildung beschreiben.
Bitte vermeiden Sie unruhige Hintergründe oder Farbverläufe in Abbildungen und Tabellen. Zudem sollte Farbe nicht als einziges Unterscheidungsmerkmal eingesetzt werden, sondern die entsprechenden Informationen sollten zusätzlich durch Text oder Form zugänglich sein.
Bei Tabellen achten Sie bitte darauf, klare Spaltenüberschriften zu vergeben und Kopfzeilen mit der entsprechenden Formatvorlage zu formatieren. Bitte vermeiden Sie Zellverbindungen, damit die Tabellen durch Screenreader vorgelesen werden können. In dem Fall ist kein Alternativtext für eine Tabelle notwendig. Bei komplexen Tabellen hinterlegen Sie bitte ebenso wie bei komplexen Abbildungen einen Alternativtext, der alle für Ihre Argumentation relevanten Elemente und Inhalte der Tabelle beschreibt.
Beispiele für unterschiedliche Varianten von Alternativtexten haben wir in der „Formatvorlage“ zusammengestellt. Zudem finden Sie auf einer Website der TU Dortmund hilfreiche Hinweise zur Erstellung von Alternativtexten: https://alternativtexte.tu-dortmund.de/informationen-und-anleitungen-1/erstellung-von-alt-texten/. (bitte auf der Website entsprechend als Link formatieren!)
Abkürzungen bei Literaturangaben
Abkürzungen wie „ebd.“, „a.a.O.“, „op. cit.“ sollen nicht benutzt werden; stattdessen wird der Literaturverweis wiederholt. Nur so lassen sich eindeutige Verknüpfungen mit dem Literaturverzeichnis herstellen.
Hervorhebungen und Namen
Hervorhebungen bestimmter Begriffe oder Lesarten sind unbedingt kursiv zu setzen, keinesfalls fett oder unterstrichen. Personennamen sind in Normalschrift zu schreiben, keinesfalls in KAPITÄLCHEN oder GROSSBUCHSTABEN.
Zahlen, Sonderzeichen und Abkürzungen
Zahlen von eins bis zwölf werden ausgeschrieben, alle höheren Zahlen in Ziffern dargestellt. Prozent und Euro werden im laufenden Text ausgeschrieben; in Zusätzen in Klammern sowie in Tabellen werden die Symbole % bzw. € verwendet.
Bei Datumsangaben wird der Monat ausgeschrieben. Ausgenommen ist das Zugriffsdatum bei Hinweisen auf Internetseiten, das als „TT.MM.JJJJ“ formatiert wird.
Gebräuchliche Abkürzungen sind erlaubt und werden ohne Leerzeichen geschrieben (z.B. „u.a.“, „d.h.“, „z.B.“).
Abkürzungen von Institutionen und Einrichtungen müssen vor ihrer ersten Verwendung eingeführt, d.h. die Bezeichnung einmal vollständig ausgeschrieben werden. Die Abkürzung wird, in runden Klammern eingeschlossen, unmittelbar angefügt. Danach kann die Abkürzung allein verwendet werden (z.B. „Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)“).
Zitate und Verweise
Literaturnachweise erfolgen direkt im Text (amerikanische Zitation nach APA 7), nicht in Fußnoten. Der Nachweis wird in runden Klammern geführt:
- bei wörtlichen Zitaten mit (Nachname, Jahr, S. xx [festes Leerzeichen zwischen „S.“ und Seitenzahl]),
- bei indirekten Zitaten und Verweisen mit (vgl. Nachname, Jahr, S. xx [festes Leerzeichen zwischen „S.“ und Seitenzahl]),
- bei Hinweisen auf Literatur insgesamt mit (Nachname, Jahr).
Direkte und paraphrasierte Zitate sind unbedingt mit Seitenzahl zu belegen! Gibt es keine Seitenzahlen, erfolgt die Angabe „o.S.“.
Auslassungen bei wörtlichen Zitaten werden durch „[…]“ kenntlich gemacht, Ergänzungen ebenfalls in eckige Klammern gesetzt.
Bis zu zwei Autorennamen werden immer angeführt; die Nachnamen werden durch „&“ miteinander verbunden (Nachname & Nachname).
Handelt es sich um mehr als zwei Autor*innen, so wird jeweils nur der*die erste Autor*in angeführt und „et al.“ ergänzt (Nachname et al.).
Mehrere Veröffentlichungen desselben Autors bzw. derselben Autorin aus demselben Jahr werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert und durch nachgestellte Kleinbuchstaben unterschieden (z.B. „Schmidt, 2009a, 2009b“).
Bei der Zitierung klassischer Autoren und Autorinnen bzw. Werke wird das Erscheinungsjahr der Erstausgabe dem der aktuellen Ausgabe nachgestellt und durch Querstrich getrennt (z.B. „Herbart, 1982/1803“).
Werden die Werke mehrerer Autor*innen in einer Klammer zitiert, sind sie in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren und jeweils durch ein Semikolon zu trennen (Beispiel: Albert, 2019; Fertig & Schöler, 2006; Zukowski, 2021). Soll ein Werk bzw. sollen Werke aus inhaltlichen Gründen zuerst genannt werden, so steht es bzw. stehen sie an erster Stelle in der Klammer außerhalb der alphabetischen Reihenfolge; vor den weiteren, alphabetisch sortierten Quellenangaben steht dann „vgl. auch“ (Beispiel: Hülsmann, 2013; vgl. auch Becker, 1999; Eickhoff, 2020).
Literaturverzeichnis und Internetquellen
Bitte führen Sie im Literaturverzeichnis ausschließlich solche Texte an, auf die Sie in Ihrem Beitrag Bezug nehmen.
Die Reihenfolge der Literaturangaben orientiert sich
- alphabetisch nach den Nachnamen,
- nach den Nachnamen der Ko-Autor*innen,
- bei mehreren Publikationen desselben Verfassers bzw. derselben Verfasserin, an den Jahreszahlen und zwar die älteste zuerst.
Im Literaturverzeichnis werden bis zu 20 Autor*innennamen angegeben. Bei zwei bis 20 Autor*innennamen steht vor dem letzten Namen ein „&“. Bei 21 oder mehr Namen werden die ersten 19 und der letzte Name aufgenommen und durch „…“ getrennt (Beispiele: „Meyer, I. & Schmidt, K.G.“; „Meyer, I., Schmidt, K.G. & Unger, W.“; „Autor*in1, A., Autor*in2, B., Autor*in3, C., Autor*in4, D., Autor*in5, E., Autor*in6, F., Autor*in7, G., Autor*in8, H., Autor*in9, I., Autor*in10, J., Autor*in11, K., Autor*in12, L., Autor*in13, M., Autor*in14, N., Autor*in15, O., Autor*in16, P., Autor*in17, Q., Autor*in18, R., Autor*in19, S. … Autor*in23, W.“).
Vor dem &-Zeichen steht kein Komma.
Digital Object Identifier (DOI)
Da die Beiträge der Journale einen DOI erhalten, muss zwingend im Literaturverzeichnis bei allen Texten, die ebenfalls einen DOI besitzen, dieser angeführt werden. Die DOIs können Sie von CrossRef – der Firma, die die DOIs vergibt – ermitteln lassen. Sie müssen sich dazu einmalig bei CrossRef mit Ihrer Universitäts-E-Mail-Adresse anmelden. Nach der Eingabe des Literaturverzeichnisses per Copy and Paste kreuzen Sie bitte rechts unter der Eingabemaske das Kästchen „List all possible DOIs per reference“ an; CrossRef ordnet dann automatisch alle vorhandenen DOIs zu. Der Dienst ist kostenlos.
URL: https://apps.crossref.org/simpleTextQuery
Fügen Sie die DOIs dann bitte wie eine URL am Ende des jeweiligen Literatureintrags als Hyperlink hinzu; hinter der Nummer wird kein Punkt gesetzt (Zenke, C.T., & Kurz, B. (2021). School as an „experimental station“: Über das Prinzip der Laboratory School und seine Verbreitung in Europa. Bildung und Erziehung 74 (1), 51–66. https://doi.org/10.13109/buer.2021.74.1.51
)
Im Einzelnen werden die Titel gemäß den Richtlinien der American Psychological Association (APA 7) wie folgt formatiert.
Grundsätzlich gilt als Und-Zeichen immer "&" (nicht "und" oder "+"); für "und andere" wird immer, auch bei mehreren Verlagen, "et al." verwendet, nicht "u.a.".
Monographien
Nachname des Autors, der Autorin bzw. der Autor*innen, Initiale(n) des bzw. der Vornamen(s) (Erscheinungsjahr). Vollständiger Titel [kursiv]. Verlag. Neu: Es wird kein Erscheinungsort angegeben. Die Auflage wird in Klammern nach dem Titel eingefügt; handelt es sich um eine veränderte Auflage, so ist dies mit einem Kürzel anzugeben (z.B. „überarb.“, „erw.“, neu bearb.“, „ak- tual.“).
Beispiel: Giesecke, H. (2000). Politische Bildung. Didaktik und Methodik für Schule und Jugendarbeit (2., überarb. u. erw. Aufl.). Juventa.
Sammelwerke
Nachname(n) des Herausgebers, der Herausgeberin bzw. der Herausgeber*innen, Initiale(n) des bzw. der Vornamen(s) [Personen durch Komma bzw. die letzten beiden durch „&“ getrennt] (Hrsg.). (Erscheinungsjahr). Titel des Bandes [kursiv]. Verlag. Neu: Es wird kein Erscheinungsort angegeben. Zur Auflage s.o.
Beispiel: Buchen, H. & Rolff, H.-G. (Hrsg.). (2006). Professionswissen Schulleitung. Beltz.
Zeitschriftenartikel
Nachname des Autors, der Autorin bzw. der Autor*innen, Initiale(n) des bzw. der Vornamen(s) (Erscheinungsjahr des Artikels). Vollständiger Titel des Beitrags. Name der Zeitschrift, Jahrgang [kursiv] (Heftnummer), Seitenzahlen der ersten und der letzten Seite (ohne „S.“!).
Beispiel: Gartenschlaeger, U. (2003). Projekt „EBIS“ – Erwachsenenbildung in Südosteuropa. Eine Zwischenbilanz. Bildung und Erziehung, 56 (2), 139–148.
Beiträge aus Sammelwerken, Jahresheften, Beiheften usw.
Nachname des Autors, der Autorin bzw. der Autor*innen, Initiale(n) des bzw. der Vornamen(s) (Erscheinungsjahr). Titel des Beitrags in dem Sammelwerk. In Initiale(n) der Vornamen Nachname(n) der Herausgeber*innen (Hrsg.), Titel des Sammelbandes [kursiv] (S. Seitenzahlen der ersten und der letzten Seite). Verlag. Neu: Es wird kein Erscheinungsort angegeben.
Beispiel: Weiß, M. & Bellmann, J. (2007). Bildungsfinanzierung in Deutschland und Schulqualität. Eine gefährdete Balance? In J. van Buer & C. Wagner (Hrsg.), Qualität von Schule (S. 167–182). Lang.
Internetquellen
Bitte orientieren Sie sich je nach Textsorte an den o.a. Zitierhinweisen. Der Titel des Online-Artikels wird kursiv gesetzt. Es folgt die herausgebende Institution bzw. der Verlag. Das Erscheinungsdatum ist so präzise wie möglich anzugeben; wenn es sich um einen bestimmten Tag handelt (z.B. bei einem Online-Zeitungsartikel), folgen auf das Jahr die Angaben (x. Monat), also z.B. (2021, 3. April). Ein Zugriffsdatum vor der URL ist nur dann erforderlich, wenn ein Text sich geändert haben kann, bspw. ein Wikipedia-Eintrag. Die Formulierung „Verfügbar unter:“ entfällt. Am Ende der URL steht kein Punkt. Liegt eine doi vor, ist diese anstelle der Internetadresse anzuführen.
Beispiel: Abs, H.J. & Veldhuis, R. (2006). Indicators on Active Citizenship for Democracy. The Social, Cultural, and Economic Domain. Council of Europe for the CRELL-Network on Active Citizenship for Democracy. http://farmweb.jrc.cec.eu.int/CRELL/ActiveCitizenship/Con- ference/03_AbsVeldhuis.pdf
Englische Titel
Bei englischen Titeln schreiben Sie bitte entsprechend den Regeln für mögliche Groß- und Kleinschreibung den ersten Buchstaben der Substantive, Pronomen, Adjektive, Adverbien und Verben groß. Verwenden Sie bitte in deutschen Texten auch bei englischen Titeln die Bezeichnungen Hrsg. für Herausgeber und S. für eine bzw. mehrere Seiten und nur in durchgängig englischsprachigen Texten entsprechend Ed(s). für Herausgeber und p. bzw. pp. für eine oder mehrere Seiten.
Copyright-Vermerk
Autor*innen, die in dieser Zeitschrift publizieren möchten, stimmen den folgenden Bedingungen zu:
Die Autor*innen behalten das Urheberrecht und erlauben dieser Zeitschrift die Erstveröffentlichung unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-ND, die es anderen erlaubt, die Arbeit unter Nennung der Autor*innenschaft und der Erstpublikation in dieser Zeitschrift zu verwenden. Die Arbeit darf jedoch nicht verändert oder umgestaltet werden.
Schutz personenbezogener Daten
Allgemein
Die Website dieser Zeitschrift ist Teil des BieJournals-Systems der Universitätsbibliothek Bielefeld.
Verantwortlich für diese Website ist die Universität Bielefeld.
Diese Datenschutzerklärung erweitert die bestehende Datenschutzerklärung der Universität Bielefeld.
Verantwortlich auf der Fachebene ist die Universitätsbibliothek.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: datenschutz.ub@uni-bielefeld.de.